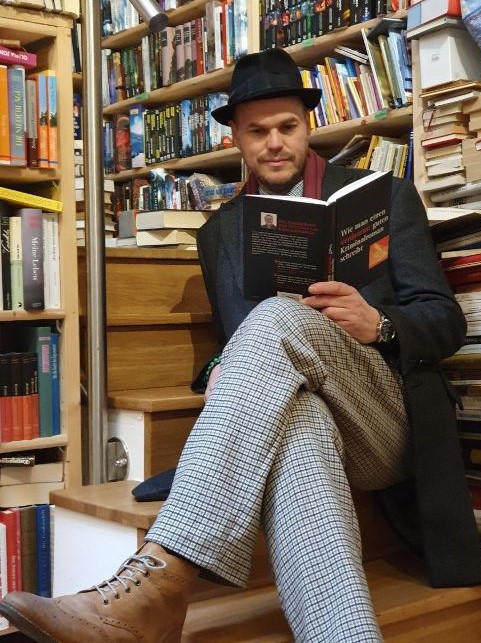James N. Freys »Standardwerk zum Krimischreiben« unter die Lupe genommen
Rezension von Bernd Friedrich von Schon
| Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links {stets kenntlich gemacht durch den Hinweis „*“ in geschweiften Klammern}. Wenn Du etwas kaufst, nachdem Du auf einen dieser Links geklickt hast, klingelt es in meiner Kaffeekasse, denn als Amazon Associate verdiene ich an qualifizierten Einkäufen. Herzlichen Dank für Deine Unterstützung, mit der ich weiterhin nützlichen Content für Dich erstellen kann! |
Laut Klappentext legt James N. Frey mit seinem Buch Wie man einen verdammt guten Kriminalroman schreibt {*} ein »Standardwerk« für das Schreiben von Krimis vor. Es kommt ebenso zupackend wie amüsant daher. Frey gilt als führender US-amerikanischer Lehrer für kreatives Schreiben, er unterrichtete u.a. an der University of California, Berkeley, ist Autor von Dramen, Romanen sowie Sachbüchern über das Schreiben.
Ich habe mir erlaubt, Freys Handwerkszeug zum Krimischreiben detektivisch unter die Lupe zu nehmen und verkoste hier die Crème de la Crème seiner Tricks.
Warum lie(b)st Du Krimis?
Frey beschäftigt sich eingangs mit der Frage, warum wir ausgerechnet Krimis lieben – handeln sie doch von so unerquicklichen Dingen wie Mord und Totschlag. Mit dieser Frage spürt er den Funktionen nach, die Krimi-Storys erfüllen. Dieser Ansatz ist aufschlussreich, denn: Zu wissen, warum wir eine Story wie aufbauen, verspricht uns Praktiker:innen von Erfolg gekrönte Ergebnisse. Wissen wir, was wir warum tun, macht ebendieses Wissen unser Tun reflektiert, effektiv und effizient, weil wir auf fest umrissene Ziele hinarbeiten. Deshalb habe ich das Aufspüren von Story-Funktionen in meinem Artikel zur Innovation des Krimigenres ebenfalls empfohlen.
Auf die Frage »Warum lieben wir Krimis?« findet Frey als Antworten:
Aufgrund …
1. … unseres Wunschs, jemand möge in unserer dunklen Welt für Gerechtigkeit sorgen,
2. … des Nervenkitzels der Verbrecher:innenjagd,
3. … der Befriedigung, wenn Übeltäter:innen ihre verdiente Strafe gewärtigen,
4. … des Gefühls des Verstehens und Bespiegelns der Wirklichkeit,
5. … des genüsslichen Erkundens der dunklen Seite der menschlichen Natur sowie …
6. … der Identifikation mit dem:der Held:in, sodass wir uns als Lesende »selbst ein wenig heroisch« fühlen.
Freys drei Krimi-Großgenres
Gleichwohl Frey das Schreiben von Krimi-Bestsellern anvisiert, dröselt er dessen ungeachtet aufschlussreich typische Merkmale unterschiedlicher Krimi-Subgenres auf. Diese ließen sich vor allem an der Gestaltung der Protagonist:innen erkennen. So sei die Hauptfigur eines Genre-Krimis ein Stück weit »theatralisch« im Sinne von überspitzt, larger than life, hiermit ein wenig unwirklich, exzentrisch, mitunter sogar comicartig, daher wiedererkennbar, zugleich aber auch ein wenig schablonenhaft gezeichnet. Detektive:innen des Mainstream-Krimis steckten häufig in einem moralischen Dilemma, litten meist unter Beziehungsproblemen, in dieser Spielart des Genres gehe es vor allem um das Leben, das die Hauptfigur führt und wie wir moralisch richtig handeln, hierbei seien sie nicht selten schmerzhaft wirklichkeitstreu. Literarische Krimi-Protogonist:innen führten ein trostloses Leben in einer dem Untergang geweihten Zivilisation.
Dass Frey in seinem Schmöker die Kreation der Figuren priorisiert, finde ich ausgezeichnet, zumal für den Krimi, denn in den schlechteren Storys des Genres dominiert doch oftmals die Rätselstruktur die Figuren, sie sind weitaus häufiger plot– als character driven.
So entwickelst Du fesselnde Figuren, …
Figuren sollten nach Frey dreidimensional sein, d.h. sie sollen physisch, sozial und psychisch entwickelt werden – also hinsichtlich ihrer körperlichen Verfasstheit (Alter, Körperbau, Gebrechen, Tics etc.), ihrer gesellschaftlichen Einbindung (Familie, Freunde, berufliches Netz) sowie ihrer geistigen Haltung (Vorlieben, Abneigungen, Ängste, Hoffnungen, Werte, Hemmungen).
… erschaffst Du schillernde Schurk:innen, …
Täter:innen bzw. Antagonist:innen bezeichnet Frey als heimliche Autor:innen des Krimis. In Zusammenhang mit der Entwicklung von Bösewicht:innen fällt dann auch mein Lieblingszitat aus Freys Buch:
»Es ist nun mal leider so, dass ein Krimautor die meiste Zeit daran denkt, jemanden umzubringen«
James N. Frey
Krimiautor:innen tun dies, um ausgeklügelte Mordpläne zu entwerfen, die als »Plot hinter dem Plot« das Räderwerk der Krimidramaturgie in Gang setzen. Eben weil der Mordplan die Struktur der Hintergrundgeschichte vorgibt, bezeichnet Frey die Mörder:innen als eigentliche Autor:innen des Krimis. Auch in diesem Punkt ähnelt Freys Methode derjenigen, in der ich Studierende in meinem letzten Krimi-Seminar unterwiesen habe.
Frey zufolge sollten Täter:innen beherrscht werden von einer brennenden Leidenschaft, es stärke sie, wenn sie durch und durch böse seien, dies aber geschickt verbärgen – sodass sie zuletzt enttarnt werden könnten. »Böse« meint hier vor allem: selbstsüchtig. Ganz klassisch empfiehlt Frey auch, dass Verbrecher:innen in der Vergangenheit verletzt wurden (Stichwort: »Backstory Wound«). Und: Dass sie, je enger sich die Schlinge um sie zuzieht, von Angst regiert werden. Für das Begehen der Tat bedürfen sie – natürlich! – eines Motivs, eines (Tat-)Mittels sowie der Gelegenheit.
… sympathische Held:innen …
Die heldische, ermittelnde Figur, sollte ebenfalls dreidimensional gezeichnet sein, von einer Leidenschaft beherrscht werden und ein besonderes Talent haben. Gerne kann sie auch ein wenig wunderlich sein, als Außenseiter:in am Rande der Normalität stehen und menschliche Makel aufweisen, die sie sympathisch machten. Im Gegensatz zur selbstsüchtigen antagonistischen Figur sollte sie aufopfernd sein und sich nach Gerechtigkeit sehnen.
… und illustre Nebencharaktere
Da im Krimi alle beteiligten Figuren zu Verdächtigen werden, benötigen auch die Nebenfiguren neben den obligatorischen drei Dimensionen (physisch – sozial – psychologisch) Tatmotive.
Insgesamt gelte: Ein Krimi bereite umso mehr Vergnügen, je gewiefter, klüger und einfallsreicher seine Dramatis Personae sind und agieren. Dem kann ich nur beipflichten.
So rundest Du Deine Figuren ab
Frey empfiehlt, für jede Figur vor dem »Plotten« der Handlung zunächst eine Biographie mit den wichtigsten Eckdaten ihres bisherigen Lebens zu schreiben. In ihrer Figurenbiographie legst Du die Verletzung fest, die Deine Figur erlitten hat und entwickelst, wie sie in den drei Dimensionen (physisch- sozial – psychisch) zu dem wurde, wer sie ist. Die Biographie dient Dir vor allem dazu, Deine Figuren zu motivieren, will sagen: zu begründen, woher jeweils ihre beherrschende Leidenschaft stammt sowie warum sie in der Backstory welche Entscheidungen getroffen haben – und während des Plotverlaufs treffen werden.
So lässt Du Deine Charaktere authentisch und individuell sprechen
Deine nächste Taktik ist, einen Tagebuchabschnitt aus Sicht der jeweiligen Figur zu schreiben, in ihrem jeweiligen Sprachduktus. So näherst Du Dich der Figur gleichsam von innen heraus, übst ihre Sprechweise, ihre sprachtypischen Eigenheiten ein, entwickelst ihre »Stimme«.
Figurenbiographie und Tagebuch-Ich-Erzählung halte ich für wertvolle Vorarbeiten, die es Dir erlauben, mit unverschämter Leichtigkeit das Figurenpersonal zu orchestrieren und lebhafte Kontraste zwischen den Charakteren zu schaffen. Überdies verflüssigen sie den späteren Schreibprozess, weil Du etliche wichtige Entscheidungen bereits getroffen hast und bereits geübt darin bist, die Figuren auf ihre je eigentümliche Weise zur Sprache kommen zu lassen.
Apropos Entscheidungen: Was mir überaus zusagt, ist, dass Frey mehrfach betont, dass im Entwicklungsprozess zwar eine Menge Entschlüsse zu fassen sind, dass sie allesamt aber stets diskutabel, revidierbar und flexibel bleiben, bis die brillanteste dramaturgische Lösung gefunden ist.
So kreierst Du einen faszinierenden Schauplatz
Frey empfiehlt, als Hintergrundkulisse für Deinen Mord einen (Tat-)Ort zu wählen, der bereits eine interessante Konfliktlage birgt, zu denen sich Leser:innen unterschiedlich positionieren müssen. In seinem Beispiel wählt er ein hinterwäldlerisches Provinznest zur Jagdsaison, das in dieser Zeit stets zum Reiseziel von Tierschützern wird, denen es darum zu tun ist, gegen das Weidwerk zu protestieren. Wendest Du Freys Kniff auf den Schauplatz Deines Verbrechens an, schwelen bereits untergründig Animositäten und Konflikte zwischen Deinen Figuren.
So gibst Du Deiner Story Struktur
Ein »verdammt guter« Krimi solle Frey zufolge die uralte, mythische Geschichte erzählen, wie ein:e Krieger:in ein Ungeheuer zur Strecke bringt und sie sich im Laufe ihres bedeutsamen Kampfes wandelt.
Die Story solle sich als Fünfakter wie folgt entfalten:
- Die Hauptfigur nimmt den (Ermittlungs-)Auftrag an,
- Die Hauptfigur wird auf die größte Zerreißprobe gestellt, »stirbt« und wird – in der Schlüsselszene – als eine veränderte »wiedergeboren«,
- Die Hauptfigur wird erneut geprüft und besteht die Probe,
- Die Hauptfigur überführt – im Höhepunkt der Story, dem »Showdown«, den:die Täter:in und macht ihn:sie dingfest.
- Der letzte Akt erzählt die Auswirkungen der Ereignisse auf die Hauptfiguren.
Freys Fünfakt-Modell – das sich von Gustav Freytags pyramidalen Dramenbau (Technik des Dramas {*}), auf Campbells Mythentheorie (Der Heros in tausend Gestalten {*}) sowie Voglers Drehbuchdramaturgie (Odyssee des Drehbuchschreibers {*}) zurückführen lässt – kommt mitunter aber für Krimis deshalb nicht infrage, weil diese oftmals Teil einer Serie sind. Es ist schlicht unglaubwürdig, dass ein:e Serienheld:in immer wieder erneut eine lebensverändernde Wandlung durchlebt. Dies ist Frey aber durchaus bewusst. Daher empfiehlt er für Serien-Hauptfiguren, dass sich im Zuge der Handlung eher die Konstellation und hiermit ihre Haltung zu ihren Mitfiguren verändert, dass beispielsweise Feinde zu Freunden werden und vice versa.

So legst Du das Fundament für Hochspannung
Frey empfiehlt, ein, wie er es nennt, »Stufendiagramm« zu verfertigen. Hiermit meint er eine Outline oder, wie es in Film- und Fernsehkreisen heißt, ein Bildertreatment, das eine jede Szene kurz skizziert.
Da Täter:in und Verdächtige hinter dem Rücken der ermittelnden Figur nicht untätig bleiben, empfiehlt Frey klugerweise, sowohl das aufzuschreiben, was »im On«, also vor Augen des:der Detektivs:in geschieht, als auch, was im Verborgenen, »im Off«, vor sich geht. Die Architektur des Krimiplots zu planen, ehe Du mit seiner eigentlichen Niederschrift beginnst, erlaubt Dir, das Handlungsgerüst mit wenig Aufwand zu optimieren. Überdies behältst Du anhand der Outline selbst bei überaus kniffligen Krimiplots den Überblick.
So entwickelst Du packende Szenen
So wie im großen Handlungsbogen die Ziele von Prota- und Antagonist:in konfligieren, so ist auch die einzelne Szene als Konflikt angelegt. Entsprechend ist‘s elementary, my dear Watson, dass Du Deinen Figuren in jeder Szene widerstreitende Absichten und Ziele gibst – im Krimi bedeutet das für gewöhnlich: Die ermittelnde Figur will etwas erfahren, die verdächtige etwas nicht preisgeben, Frey spricht von dem Prinzip »Beharren versus Widerstand«.
Im Zuge des sich entwickelnden Konflikts vollzieht sich der Höhepunkt der Szene als Umkehr, in der eine der Figuren ihr Ziel erreicht und die Antagonie versiegt. Die Figuren reagieren auf den Umschwung in emotionaler Hinsicht, verlassen die Szene verändert. Gute Endzeilen schlügen einen Bogen zur nächsten Szene, auf dass Dein Krimi zum sprichwörtlichen Pageturner wird, der sich nur mit größter Überwindung aus der Hand legen lässt.
So entführst Du Dein Publikum in die Welt Deiner Story
Frey nennt fünf Techniken, mit denen Du die Aufmerksamkeit Deines Publikums weckst und es regelrecht in Deine Fiktion hineinsaugst:
- Das Aufwerfen brennender Fragen zum Verlauf der Geschichte,
- Sympathie – die aus Mitleid für eine Figur entspringt, sodass sich das Publikum emotional an sie bindet,
- Empathie – indem Du Deine Leser:innen die Gefühle Deiner Figuren nachempfinden lässt,
- Identifikation – indem Du Deinen Figuren Ziele gibst, von denen Deine Leser:innenschaft sich wünscht, dass sie sie erreichen sowie …
- … innere Konflikte, einander widersprechende Wünsche, sodass Dein Publikum rätselt, wie sich Deine Figuren im Handlungsverlauf entscheiden werden.
Frey nennt als weitere, unabdingbare »vier Säulen der Kriminalliteratur«: Geheimnis, Spannung, Konflikt, Überraschung. Die erwähnten Ingredienzen sind nahezu identisch mit den »vier Spannungsmitteln«, die ich in meinem Blogartikel zum Krimischreiben beschrieben habe.
So wählst Du Deine Erzählperspektive
Ein Ich-Erzähler schildert nur, was er wahrnimmt, fühlt und denkt. Indem Du den:die Ermittler:in selbst erzählen lässt, kannst Du ein Maximum an Identifikation erreichen und Deinem Publikum den Ehrenplatz bieten, am Puls des Geschehens und stets auf der Höhe der Detektion zu sein. Hiermit schränkst Du aber nicht nur das »Gesichtsfeld« ein – Du kannst nur berichten, was die ermittelnde Figur erlebt oder erfährt –, auch stilistisch legst Du Dich auf die Sprache nur einer Deiner Figuren fest. Erzählst Du in der dritten Person, ermöglicht Dir das, multiperspektivisch zu erzählen und auch stilistisch zu variieren, als Erzähler:in einerseits und als erzählende bzw. denkende/fühlende Figur(-en) andererseits.
So schreibst Du wie Paganini
Wenn Biographien und Tagebücher erstellt sind, die Outline steht, die Szenen grob umrissen sind und die Erzählperspektive gewählt ist, favorisiert‘s Frey, den ersten Entwurf prestissimo zu schreiben, möglichst in einem Zuge und aberwitzig schnell – was uns übrigens auch sein Drehbuchkollege William Goldman (Das Hollywood-Geschäft {*}) ans Herz legt. Frey empfiehlt überdies, kontinuierlich zu Schreiben, um das Handwerk nicht einrosten zu lassen. Hierzu rät er, dass Du als Tagesziel rund 1200 Wörter zu Papier bringst – das sind fünf bis sechs Rohentwurf-Manuskriptseiten, die Du im Überarbeitungsprozess dann wieder auf etwa drei Seiten straffst.
So bringst Du Deine Story zum Glänzen
Apropos Überarbeitungsprozess: Nicht unerwähnt lässt Frey, dass die erste Fassung niemals die letzte ist, dass erst der Feinschliff aus einem Rohdiamanten das Schmuckstück macht.
Anhand seines eigenen Werkstücks zeigt er in vier Entwicklungsstufen den Prozess der Textpolitur: wie er den Aufbau strafft, die Sprache aktiviert, Dialoge optimiert, passende Metaphern findet, sinnliche und aufschlussreiche Details akzentuiert. Bei der Lektüre siehst Du gleichsam dem erfahrenen Krimiautoren bei der Arbeit über die Schulter und wirst en passant von ihm unterwiesen.
So schreibst Du einen fesselnden Stil
Frey zufolge sei hochwertige Prosa klar, effizient, sie verwende sinnliche Details (wobei sie verschiedene Wahrnehmungskanäle ansprechen solle, nicht allein den Gesichtssinn), setze Metaphern sparsam und aussagekräftig ein, benutze Vollverben im Aktiv und sei emotional, indem Du deutlich machst, wie Deine Figuren wahrnehmen und empfinden.
Um die Spannung aufrechtzuerhalten, verwendeten Kriminalschriftsteller:innen aber nicht nur sinnliche, sondern ebenfalls aufschlussreiche Details. Hiermit meint er folgendes: Lesende beobachten – gleichwie die ermittelnden Figuren – aufmerksam, entwickeln eigene Theorien und ziehen ihre Schlüsse. Entsprechend verraten ihnen Hinweise etwa zum Kleidungsstil, Arbeitsplatz, zu Gewohnheiten und Verhaltensweisen von Verdächtigen etwas über die Charaktere und womöglich auch zum aufzudeckenden rätselhaften Verbrechen.
So wirst Du Meister:in Deines Fachs
Meisterschaft erreichst Du, indem Du die Todsünde für Autor:innen unterlässt: Nichts Neues zu produzieren. Entwickelst Du stetig Neues und bleibst ein:e beharrlich Schreibende:r, kommst Du gar nicht umhin, Dich en passant stetig weiterzuentwickeln. In einem Video-Interview bringt Frey es auf den Punkt:
»Schreiben ist eine Geisteskrankheit«
James N. Frey
Die besten seiner Studierenden, so Frey, seien Besessene, die gar nicht anders könnten, als zu schreiben.
So können Lektor:innen und Agent:innen Dein Manuskript nicht ablehnen
Zuletzt gibt Frey Tipps an die Hand, wie Du Deinen fertigen Krimi anbietest. Hierbei mag ihm geholfen haben, dass er vor seiner Tätigkeit als Schriftsteller als Vertreter von Haus zu Haus ging.
Kaum habe Autor:in das Krimi-Manuskript fertiggestellt, solle sie:er sich vom »kreativen Genie« in einen »Marketingfreak« verwandeln. Du solltest Dich informieren, welche Agent:innen auf welche Art Bücher spezialisiert sind und sie beharrlich anschreiben. Hierzu fertigst Du ein Exposé an, in der Du Deine Arbeit mit derjenigen von erfolgreichen Krimiautor:innen vergleichst, idealerweise solche, die der:die Agent:in vertritt. Hierbei helfe es, wenn Dein Krimi der erste einer Serie sein könne.
Mein Fazit: »Verdammt gut«?
Freys Buch führt definitiv nicht kulturgeschichtlich in die Gattung des Kriminalromans ein, auch vermittelt es mitnichten einen systematischen Überblick über alle seine Spielarten, ebenso wagt es keinesfalls Prognosen über neueste Trends im Krimigenre. Das ist aber auch gar nicht sein Anliegen.
Frey vermittelt praxisnahe, verlässliche Methoden, um spannende Krimiplots zu entwickeln – und hier vor allem für das Medium »Roman«.
Gleichwohl Frey in erster Linie Romanautor:innen anspricht, eignen sich seine Techniken auch dann für Dich, wenn Du Deines Zeichens Drehbuch- oder Theaterautor:in, Dramaturg:in oder gar Game Designer:in bist. Von seinen Handreichungen für gute Prosa können sicherlich auch Journalist:innen oder Blogger:innen profitieren.
Frey zählt zweifelsohne zu den »Plottern«, das heißt: denjenigen, die den Handlungs- und Spannungsaufbau sorgsam planen, ehe sie mit der Niederschrift beginnen – im Gegensatz zu »Pantsern«, die ihrer Schreib- und Fabulierlust freien Lauf lassen und eher rückwirkend straffen, korrigieren, umgruppieren und polieren. Wenn Du Freys Ansätzen folgst, arbeitest Du folglich effizient und schreibst nicht ungeplant drauflos.
Frey gelingt überdies der Spagat, Anfänger:innen und Fortgeschrittene gleichermaßen sachkundig zu unterweisen.
In mancher Hinsicht argumentiert mir persönlich Frey ein wenig zu ausschließlich, zu überzeugt davon, dass nur (s-)eine Erzählstruktur die einzig erfolgversprechende ist. Meine Erkenntnis: Unterschiedliche Sichtweisen auf unsere Welt und uns Menschen erfordern unterschiedliche Erzählstrukturen und -stile. Schließlich gibt es in der Kunst, wenn sie diesen Titel verdient, kein „richtig“ und „falsch“, sondern es fragt sich, ob sie eine ihrer jeweiligen Botschaft angemessene Form gewählt hat. Da Freys Buch aber viel „verdammt Gutes“ bietet, find‘ ich’s verzeihlich, dass er vor Selbstbewusstsein strotzt und von seiner Erzählstruktur überzeugt ist.
Indem er einen exemplarischen Krimiplot von Grund auf entwickelt und er uns als Leser:innen dabei zuschauen lässt sowie seinen Arbeitsprozess kommentiert, gewährt er wertvolle Einblicke in die Werkstatt eines Krimiautoren. Als weiteren Vorzug hat sein Schmöker einen klaren, leichtverständlichen, mitunter ziemlich amüsanten, lässigen Sound.
So kann ich Freys Wie man einen verdammt guten Kriminalroman schreibt {*} jedem ans Herz legen, der erlernen möchte, ästhetische Verbrechen zu begehen, sie aufzuklären und davon zu erzählen.
Euer