Ein szientifischer und zugleich praxisnaher Bestseller
Rezension von Bernd Friedrich von Schon
| Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links stets kenntlich gemacht durch den Hinweis „{*}“ in geschweiften Klammern. Wenn Du etwas kaufst, nachdem Du auf einen dieser Links geklickt hast, klingelt es in meiner Kaffeekasse, denn als Amazon Associate verdiene ich an qualifizierten Einkäufen. Herzlichen Dank für Deine Unterstützung, mit der ich weiterhin nützlichen Content für Dich erstellen kann! |
»Sapere aude – habe Mut, sonst verpasst Du etwas!«
Das ist mein Rat an all jene, die den Titel »The Science of Storytelling« {*} (»Die Wissenschaft des Geschichtenerzählens«) lesen und denen‘s infolge dessen unbehaglich wird, weil sie befürchten, es könnte allzu theoretisch, gar staubtrocken werden.
Denn: Das Buch des britischen Journalisten und Romanciers taugt als Ratgeber, lohnt der Lektüre für uns Erzähler:innen. Hirnforschung, Neurowissenschaft und Psychologie zieht der Autor nur deshalb zurate, um uns dabei zu helfen, drei große Herausforderungen des Storydesigns zu meistern.
Sollte Euch die Lektüre – zumal das Buch bislang lediglich auf Englisch vorliegt – dennoch schrecken, bleibt unverzagt: Meine Buchkritik bietet eine Zusammenfassung von Storrs wichtigsten Strategien, Taktiken, Methoden, Tricks und Tipps.
Antworten auf drei Storydesign-Herausforderungen
Die großen Drei, für die Will Storr Lösungen findet:
1. Wie geben wir unseren Geschichten Zugänglichkeit, Spannung, Nachvollziehbarkeit und Menschlichkeit?
2. Wie erschaffen wir lebendige Figuren?
3. Wie verbinden sich unsere (Haupt-)Figur(-en) organisch mit unserem Plot?
Dass Storr von allgemein-menschlichen Grundlagen ausgeht – dem Aufbau unseres Gehirns, unserer Psyche und ihrer Entwicklung –, ermöglicht ihm, effektives Erzählen von universeller Warte aus zu untersuchen und begreiflich zu machen, wie es gelingt.
Erzählen dient (sozialem) Survival
Ähnlich wie Lisa Cron in Wired for Story {*} geht Storr – evolutionsbiologisch – davon aus, dass uns seit Menschengedenken vor allem zwei Beweggründe antreiben: 1. Unser Wunsch, zu überleben und 2. unser Wunsch, uns fortzupflanzen.
Da wir, so Storr, einer hypersozialen Spezies angehören, ergeben sich für uns als menschliche Individuen aus den beiden Beweggründen »Überleben« und »Fortpflanzen« wiederum zwei Ziele, nämlich 1. innerhalb unseres »Stammes« miteinander auszukommen, aber auch 2. voranzukommen, d.h. andere zu überflügeln. Denn beides – »uns mit Mitmenschen verbinden« und »Mitmenschen dominieren« – steigert unsere Chancen, zu überleben, ein erquickliches Liebesleben zu pflegen und, infolge dessen, auch Nachwuchs zu haben.
Dies liest sich recht nüchtern, verwirklicht sich aber darin, dass die meisten Storys die Bindung unter Menschen zum bestimmenden Sujet machen. So fanden Jodie Archer und Matthew L. Jockers vom Stanford Literary Lab beim algorithmischen Durchforsten von rund fünftausend Romanen – darunter fünfhundert New-York-Times-Bestseller – heraus, dass das Thema »menschliche Nähe« das wichtigste von allen ist, nachzulesen in ihrem Buch Der Bestseller-Code {*}.
Wer sind die anderen? Und wer bin ich?
Aus den Zielen, mit Mitmenschen aus– und unter ihnen voranzukommen wiederum ergeben sich als Zielsetzungen für unser – hypersoziales – Gehirn: Es muss andere Bewusstseine, deren Absichten und Pläne, dechiffrieren, sich in sie hineinversetzen, um schnellstmöglich die Frage zu beantworten: »Freund oder Feind?«. Überdies muss es durch ein soziales Netz aus unseren Mit-Bewusstseinen, unseren Stammesmitgliedern, navigieren und versuchen, unsere (eben auch: soziale) Umwelt zu kontrollieren.
Entsprechend ist unsere Neugier auf Menschen unersättlich: Wie stehen sie zu uns? Was denken sie? Was planen sie? Wen lieben sie? Wen hassen sie? Was sind ihre Geheimnisse? Was ist ihnen wichtig? Wie wurden sie zu denen, die sie sind?
Umso neugieriger werden wir, je weniger vorhersehbar sich Menschen um uns herum verhalten. Entsprechend sind »unberechenbare« Charaktere der beste Stoff für Erzählungen. So ist denn auch Storrs Ansatz charakter-, nicht plotgetrieben (»character driven«).
Für Storr ist die zentrale dramatische Frage: »Wer ist diese Person?« – oder, aus Sicht der Hauptfigur: »Wer bin ich?«.
Erzählen – wozu?
Welche Rolle spielt nun aber das Erzählen?
Zunächst einmal: Erzählen ist etwas Natürliches. Ein funktionierendes Gehirn zeichnet sich dadurch aus, dass es sein Leben im »Story-Modus« erfasst, Geschichten sind für uns als Spezies so selbstverständlich wie unser Atem – weshalb Storr zu Beginn seines TED Talks seinen Zuhörer:innen nicht von ungefähr schmeichelt, sie müssten Storytelling nicht erst mühsam erlernen, sie seien längst fantastische Erzähler:innen.
Unser Gehirn ist ein Geschichtenprozessor, unentwegt verfertigt es aus unseren Erfahrungen Storys – und schildert uns dabei als die Held:innen unseres Lebens, die hehre Ziele verfolgen – und es stellt uns Bösewicht:innen entgegen, die unsere Ziele zu vereiteln suchen.
Während unser Hirn der Mission folgt, Antworten auf die einfache Frage zu finden »Wie kontrolliere ich meine äußere und innere Welt?«, um »Überleben« und »Fortpflanzen« zu sichern, bemerken wir doch immer wieder, dass wir – und auch andere – uns irren, falsche Annahmen zugrunde legen, Fehler machen und hiermit unsere ureigenen Ziele gefährden.
Ein Psychologieprofessor, den Storr zitiert, sagt‘s folgendermaßen:
„Alle menschlichen Individuen sind Forscher, die Annahmen über die Welt aufstellen und testen, hierbei Erfahrungen sammeln, unser Verhalten entsprechend anpassen – und sich dabei verändern.“
Brian Little
Diese bedeutsamen, verändernden Erfahrungen geben wir durch Erzählen an unsere Mitmenschen weiter.
Erzählen dient so 1. der Weitergabe (überlebens-)wichtigen Rats in der Form von beispielsweise: »Diese Pflanze duftet zwar schmackhaft, ist aber giftig«, aber auch sozial bedeutsamer Information, wie etwa: »Wenn Du Dich ihm so näherst, wird er Dich abweisen. Um ihn zu verführen, solltest Du stattdessen …«.
»Leben ist Wandel, das sich nach Stabilität sehnt«
Roy Baumeister
Und Geschichten sind Spiele, die uns zeigen, wie es sich anfühlt, Stabilität und Kontrolle zu verlieren (ohne uns dabei tatsächlich in Gefahr zu bringen) und, wie man die Kontrolle über die Welt (zurück-)erlangt.
Brennend interessiert uns: Wie überwinden wir »Schwächen« im Sinne von: Wie vermeiden – oder wenigstens: verringern – wir Abhängigkeit, Fremdbestimmung und Ausgeliefertsein? Und: Wie erlangen wir »Stärke« im Sinne von Kontrolle unserer inneren und äußeren Lebenswelt?
Überdies dient Erzählen 2. dem Aushandeln und Bewerten von einerseits erwünschtem und andererseits unliebsamem Verhalten. Storr geht soweit zu sagen, dass menschliche Kommunikation aus »Gossip«, also Klatsch und Tratsch, erwuchs – mit dem Ziel, Verhalten zu beeinflussen.

[KI-Generiertes Bild von Hominiden, unseren Vorfahren, beim Austausch von Klatsch und Tratsch]
Erzählen erarbeitet die Werte eines »Stammes«, rühmt sozial erwünschte und ächtet sozial inakzeptable Manieren und dient für den »Stamm« somit als Ein- und Ausschlussverfahren: Wer gehört zu uns, wer nicht – und wen müssen wir verbannen? Storr zufolge gelte: Je mehr Geschichtenerzähler:innen ein Stamm aufweist, desto stärker verbreite sich prosoziales Verhalten.
„Storys entstanden aus unserem regen Interesse an sozialem Monitoring.“
Brian Boyd
Held:innen und Bösewicht:innen
Unser Hirn porträtiert Mitmenschen so nicht nur dann als Antagonist:innen, wenn sie unseren Zielen im Wege stehen. Wir empören uns auch moralisch über sie, wenn ihr Verhalten unseren verinnerlichten »Stammes«-Werten und -Erzählungen zuwiderläuft. Dieses unsrige Tribalverhalten lässt sich leicht triggern, wenn etwa eine Figur von anderen unverdient übervorteilt wird. Angesichts solcher Ungerechtigkeit ergreifen wir impulshaft Partei für das Opfer und sehnen uns danach, dass Übeltäter:innen bestraft werden, gewinnen oftmals gar fragwürdige Genugtuung aus handfester Sühne.
Held:innen sind für uns entsprechend unseres atavistischen Erbes diejenigen, die sich selbstlos für (die) Werte (unseres »Stammes«) einsetzen, etwas oder gar sich selbst für sie opfern und die sich erst im Zuge ihres Weges von einem niedrigen Status, von Ohnmacht und Verletzlichkeit, emporarbeiten, erst allmählich und unter Anstrengungen ihre Schwächen überwinden, die jene unter ihnen auf der Leiter der sozialen Hierarchie schützen, ihnen Verständnis und Mitgefühl entgegenbringen – sich ihren Held:innenstatus also ehrlich, hart und redlich verdienen.
Antagonist:innen sind demgegenüber diejenigen, die selbstsüchtig sind, ihre Macht und Fähigkeiten missbrauchen und sie eben nicht zum Wohle aller (unseres »Stammes«) einsetzen, sondern willkürlich allein für ihr eigenes Gutdünken, die auch nicht darauf bedacht sind, sich an ihre soziale Umwelt anzupassen.
Neugier wecken, in unsere (Story-)Welt entführen
Beisammen haben wir als Spannungsmittel bereits, dass wir auf eine (oder mehrere) interessanten – im Sinne von »unberechenbaren« – Figur(-en) treffen, denen Widersacher:innen übel mitspielen, sodass wir nach ausgleichender Gerechtigkeit lechzen.
Storr bietet aber noch eine Reihe weiterer Verfahren an, die unsre Neugier wecken, Spannung erzeugen und dabei helfen, unser Publikum in unsere Welt und Geschichte zu entführen:
- Überraschender Wandel: Unser Gehirn ist besessen von Veränderung. Bei seiner Mission, unsere innere und äußere Welt zu kontrollieren, ist es überfordert, denn: Es kann nicht alle Details überblicken. Daher kapriziert sich unser Denkorgan auf das, was sich ändert. Weil: Veränderung könnte »Gefahr« bedeuten, aber, au contraire, auch »Chancen« für uns bereithalten. Entsprechend sind Erzähler:innen gut beraten, mit einem unvorhergesehenen Wandel in die Geschichte zu starten oder aber mit der düsteren Ahnung, dass nichts bleiben wird, wie es ist.
»Der Schrecken liegt nicht im Knall, sondern in der Erwartung des Knalls.«
Alfred Hitchcock
- Show, don‘t tell (»Nicht erzählen, sondern zeigen«): Unser Hirn modelliert in jedem Augenblick aus einem recht spärlichen Datensatz eine komplette Wirklichkeitsillusion. Ebenso entzündet sinnliches Storytelling die Imagination seiner Leser:innen: Nenne spezifische Details der fiktiven Welt: Wie fühlt sie sich an, riecht sie, klingt sie? Verwende auch »sprechende« Details, die den Hirnen Deines Publikums bei seiner Mission helfen, etwas über Menschen zu erfahren: Was verrät ein Tic, ein buntes Kleidungsstück, ein geliebter Gegenstand über Deine Figur? Wenn einer Figur Schreckliches widerfährt, benenne es nicht als schrecklich, sondern sorge dafür, dass das rezipierende Hirn sich ein Modell eben dieses Schrecklichen entwickeln muss – weil etwa der heiße Atem des schuppigen Untiers einen fauligen Fleischgeruch verströmt. Benutze aktive Sprache, verkette Worte »cinematisch«, sodass unweigerlich ein lebhafter Geschehensablauf vor dem inneren Auge Deiner Zuschauer:innenschaft entsteht.
- Statusspiele: Da uns Menschen wichtig ist, miteinander auszukommen, aber auch voranzukommen, evaluieren wir stets unseren eigenen Status und den unserer Mitmenschen. Wir reagieren sensibel auf Machtgerangel, Konflikte um Beliebtheit und Gunst der Mächtigen. Gutes Storytelling zeigt Menschen, die Status erringen (wollen), Status verlieren, ihren Status zurückerkämpfen. Statusveränderungen bergen wertvolles Erzählpotenzial – sie bilden die Grundlage von Storys über Ambitionen, Loyalität, Betrug, Intrigen, Verschwörungen und Allianzen, über Niederlage, Verzweiflung und Triumph sowie über das Verlieren und Gewinnen der Liebe. Storr hat ein eigenes, weiteres Buch zu dem Thema verfasst: The Status Game {*}.
- Lücken, Leerstellen, Auslassungen: Unsere Gehirne versuchen, zu verstehen, was vor sich geht und fahnden nach den Beweggründen für menschliches Verhalten. Um »Kontrolle« zu erlangen, müssen wir richtig verstehen. Die Sprache unseres Gehirns ist »Kausalität«: Solange wir nachvollziehen können, welche Ursachen zu welchen Wirkungen führen, begreifen wir, was vor sich geht. Entsprechend fuchsen uns Lücken in unserem Wissen, weshalb effizientes Storytelling nicht ohne Grund Geschehensabläufe mit ungewissem Ausgang inszeniert, Fragen aufwirft, Puzzles präsentiert, uns vor Rätsel stellt, unsere Erwartungen desavouiert, von Geheimnissen raunt, etwaige Lösungen andeutet sowie Personen auftreten lässt, die, im Gegensatz zu uns, offenbar wissen, was insgeheim vor sich geht.
- Metaphern wirken ähnlich wie Rätsel. Wenn sie frisch sind, müssen wir, um sie zu begreifen, uns das heraufbeschworene Bild zunächst sinnlich vorstellen. So werden sie nicht allein als eine Art Vergleichsspiel »verstanden«, sondern können regelrecht »erlebt« werden.
Vom Charakter zur Story
Nach Storr ließe sich eine »Story« wie folgt definieren:
Eine spezifische Person (»Hauptfigur«) mit individueller Art und Weise, ihre innere und äußere Welt kontrollieren zu wollen, wird mit Hindernissen und Ereignissen (dem »Plot«) konfrontiert, die sie zwingen, sich (das ist vor allem: »ihre Art, Kontrolle erlangen zu wollen«) zu ändern.
Hierbei durchdringen und bedingen sich »äußere« Ereignisse (der »Plot«) und »inneres« Seelenleben der Hauptfigur (»Wünsche, Sehnsüchte, Triebe, Hemmnisse, innere Konflikte«).
»Sich ändern« meint hierbei: Die Hauptfigur muss etliche Male Entscheidungen treffen, die die zentrale dramatische Frage immer wieder neu und anders stellen: »Wer ist diese Person?«, »Welche Wahl wird sie treffen?«, »Zu wem wird diese Person (durch ihre Wahl und deren Folgen) werden?«
Aufgabe der Plotereignisse ist hierbei, ein fehlerhaftes Glaubenssystem der Hauptfigur zu prüfen, als untauglich zu überführen und es schmerzhaft zu zerbrechen. So entdeckt die Hauptfigur peu à peu, unter steigendem Druck, »wer sie ist« – und wird nicht selten überrascht von den Antworten auf die »dramatische Frage«.
Ein:e »Held:in« ist, so besehen, die Person, die die Herausforderung ihrer Story annimmt, sich von ihren irrigen, fehlerhaften Modellen verabschiedet, sich zum Guten wendet und verändert, eine neue, triftigere Sicht der Welt erlangt.
Ein:e »Anti-Held:in« wiederum ist die Person, die auf ihrem fehlerhaften Glaubenssatz beharrt, Veränderung ausschlägt und dadurch scheitert – oder die ein wertekonformes Modell verwirft und stattdessen einem sinistren, moralisch verwerflichen Modell zur Kontrolle ihrer Welt den Vorzug gibt.
Spezifisches »Ur-Ereignis« führt zu irriger »Kontrolltheorie«, …
Oft genug führt effektives Storytelling nicht nur voran zu dem, »wer die Hauptfigur sein wird«, sondern auch zurück zu dem »Ursprungsereignis«, durch das sie wurde, wer sie (bislang) war – zu denken sei etwa an Charles Foster Kanes »Rosebud«-Rätsel und dessen »Auflösung« in Orson Welles‘ weltberühmten Film Citizen Kane {*}.
So verbindet sich das Muster des (voranschreitenden, zukunftsorientierten) »Entfaltungsdramas« mit dem Muster des (rückwärts gerichteten, vergangenheitsorientierten) »Enthüllungsdramas« – dessen Einfluss auf das Crime-Genre ich in meinem Blogue-Artikel über Innovation im Krimigenre skizziert habe.
Das Ur-Ereignis führt bei der betroffenen (Haupt-)Figur zu einer fehlerhaften, verzerrten Annahme, wie sie Kontrolle über ihre Welt erlangen könne. Storr nennt diese Annahme »Theorie von Kontrolle« (»Theory of Control«). Sie beschreibt (aus Sicht der Figur), was sie tun müsse, um das zu bekommen, was sie will und das zu vermeiden, was sie fürchtet.
Ich werde diese »Theory of Control« im Weiteren schlicht »Kontrolltheorie« nennen, was zwar klingt, als sei sie eine Theorie zur Kontrolle i.S.v. Überprüfung von etwas, obwohl hier demgegenüber Annahmen darüber gemeint sind, wie Kontrolle erlangt werden kann. Dies sei mir der Einfachheit halber aber gestattet.
Weiter im Text: Diese ihre spezifische »Kontrolltheorie« vermittelt der Figur ein Bewusstsein von Überlegenheit. Hierbei wirkt sie im Unbewussten der Figur. Denn: Laut Neurowissenschaft seien unsere eigenen Schwächen für uns selbst (oftmals) ebenso unsichtbar wie die Ursprünge unserer Stärken.
Die lebendigsten Charaktere seien Storr zufolge diejenigen, die von einer irrigen »Kontrolltheorie« besessen sind – als Beispiele nennt er Dickens‘ Ebenezer Scrooge und Melvilles Kapitän Ahab.
So schlägt Storr denn auch zur Entwicklung überzeugender Charaktere vor, mit ihrer fehlerhaften »Kontrolltheorie« zu beginnen.
Ihr spezifischer, irriger Glaubenssatz, so ihre Annahme, hilft ihnen dabei, ihre (soziale) Umwelt zu kontrollieren.
Um eine produktive »Kontrolltheorie« für Deine Hauptfigur zu entwickeln, hilft es, folgende Sätze zu vervollständigen:
- »Menschen bewundern an mir … «
- »Ich bin nur sicher, wenn … «
- »Das Wichtigste im Leben, das offenbar nur ich begreife, ist … «
- »Das Geheimnis des Glücks ist … «
- »Der beste Rat, den ich jemals bekam, war … «
Eine taugliche »Kontrolltheorie« sollte Hoffnungen, Ziele und (unbewusste) Ängste der Figur beinhalten. Sie beantwortet die Fragen: »Wer muss ich sein und wie muss ich handeln, um meine Ziele zu erreichen (d.h. Kontrolle zu erlangen)?« und zugleich: »Zu wem darf ich niemals werden, was darf ich niemals tun, da sich ansonsten meine größte Angst verwirklicht?«
Da der Plot später zeigen wird, dass die »Kontrolltheorie« der Figur fehlerhaft ist, wirkt sie nicht allein als »Stärke« der Figur, sie hat eine Kehrseite, wird – unter spezifischen Bedingungen (die der Plot erschaffen wird) – zur »Schwäche«.
Oben genanntes Ur-Ereignis, dem die (schadhafte) »Kontrolltheorie« entspringt, liegt meist in Kindheit oder Jugend, da wir Menschen in diesem Zeitraum leicht zu prägen sind.
Storr zufolge lohnt es, es als präzise, festumrissene Situation auszuarbeiten. Oftmals ist das Ur-Ereignis eine traumatische Demütigungserfahrung, die zur irrigen Annahme führt, die sich dann zu einem beharrlichen – falschen oder bestenfalls halbwahren – Glaubenssatz verfestigt.
Die Figur beginnt, diese Annahme zu testen, zu prüfen, ihr zu folgen, ihr zu vertrauen, sie wächst sich zur Attitüde aus, wird »heilig« im Sinne von »unumstößlich wahr« für die Figur und – da mit ihren unbewussten Ängsten verquickt – »unantastbar«. Sie beginnt, das Sein und Leben der Figur vollumfänglich zu bedingen: Ihre spezifische Überzeugung bedingt die Perspektive der Figur, aus ihr heraus entwickelt sich ihre Biografie: Was für sie von Bedeutung ist, welche Ziele sie auf welche Weise verfolgt, welche Dinge ihr Unbehagen bereiten, worauf sie vertraut, welche Art von Beziehungen sie führt, welches Leben sie um sich herum erschafft.
… führt zum »Entzündungspunkt«, schließlich zur Antwort auf die »dramatische Frage«.
»Ur-Ereignis«, »Kontrolltheorie«, »Perspektive« und »Biografie« bilden die Vorgeschichte, sie sind uns für gewöhnlich allesamt unbekannt, wenn wir der Figur in ihrer Geschichte zum ersten Mal begegnen. Bei deren Aufbau orientiert sich Storr an der klassischen Fünfaktstruktur – wie sie Gustav Freytag in seiner Technik des Dramas {*} prototypisch ausformulierte. Denn diese sei das erprobteste und verlässlichste Muster, darzustellen, wie eine Hauptfigur mit einer Herausforderung konfrontiert wird und sich zu deren Bewältigung verändern muss.
Storr verweist darauf, dass David Robinson 112.000 Plots analysierte und ein ihnen gemeinsames Grundmuster zutage förderte: Die Hauptfigur muss eine Herausforderung bestehen, alles verschlimmert sich, bis sie eine bedeutende Prüfung übersteht. Dieses Grundmuster bildet auch die Basis der Fünfaktstruktur, wie Storr sie für sich adaptiert.
En bref werde in der ersten Hälfte der Fünfaktstruktur die Kontrolltheorie etabliert, die im »Midpoint« transformiert wird. In der zweiten Hälfte werde die neue Kontrolltheorie dann bis aufs Äußerste geprüft, sodass die Story auf eine finale Entscheidung im letzten Akt hinausläuft: »Wird die Hauptfigur die neue Kontrolltheorie annehmen oder auf ihrer alten beharren? Wer wird sie sein?«
Jeder Akt hat hierbei ein zentrales Ereignis, auf das die Hauptfigur antworten muss.
I. Akt: »Das bin ich – und es funktioniert nicht«
Zu Beginn, in der Exposition, werden die Figur und ihr Leben, ihr Alltag, ihre Ziele und Ambitionen vorgestellt, geheime Verletzungen werden angedeutet, als eine »unerwartete Veränderung« zuschlägt.
Storr nennt die gestellte Herausforderung »Story-Ereignis«. Dieses »Story-Ereignis« kann – je nach Art der Geschichte, ihrer Gattung und ihrem Genre – vielerlei sein: eine Gelegenheit, eine Intrige, eine Suche, Reise, eine Ermittlung, ein Missverständnis, eine Enthüllung, eine Niederlage, eine Anschuldigung, eine Entdeckung, ein plötzlich auftretender Feind oder Monster, eine unwillkommene Figur aus der Vergangenheit, eine Ungerechtigkeit, eine Entdeckung, eine Versuchung …
Die Herausforderung führt unsere Hauptfigur in einen neuen, ihr unbekannten (psychischen) Bereich. Bei dem Ansinnen, die überfordernde Aufgabe zu lösen, verfährt die Figur gewohnheitsmäßig, entsprechend ihrer ur-sprünglichen »Kontrolltheorie« – und scheitert, verschlimmert ihre Lage nurmehr. Was nun?
II. Akt: »Gibt es einen anderen Weg?«
Die Figur ist ratlos, versinkt im Chaos, realisiert, dass eine neue Strategie gefunden werden muss. Sie beginnt verzweifelt, zu experimentieren – auch mit neuen Versionen ihrer selbst.
In dieser Krise stellt sich die dramatische Frage: »Wer wird die Hauptfigur werden müssen, um die Herausforderung zu bestehen?« Denn: Gezeigt hat sich bereits, dass die Figur mit Antworten aus ihrem Standardrepertoire (ihrer »Kontrolltheorie«) nicht weiterkommt.
Jetzt beginnt sie, neue Wege zu gehen, die zunächst Irrwege sein mögen, sie kann aber auch kleine Triumphe erringen.
Bei einem abermaligen Versuch zeigt sich dann, im, wie Storr ihn nennt, »Entzündungspunkt« (»Ignition Point«), eine neue Facette der Hauptfigur. Sie reagiert (unter Umständen sogar für sich selbst) unerwartet, sie überrascht uns und weckt daher unsere Neugier. Denkbar wird nun erstmals ein mögliches neues Selbst, eine andere Version, eine Perspektive, »wer die Figur werden könnte«.
Die Hauptfigur entscheidet sich schließlich, beim Einschlagen des neuen Weges alles zu geben.
III. Akt: »Ich bin verwandelt«
Als Reaktion auf diese neue Facette der Figur reagiert dann aber das »Gegenspiel« mit voller Wucht.
Widersacher:innen setzen der Hauptfigur arg zu, deren ersten Versuche noch unzulänglich, amateur- und stümperhaft und überhastet sind – so stellt sich immer wieder neu, unerwartet frisch die dramatische Frage: »Wer wird die Figur (zuletzt) sein?« Denn: Der Preis wird deutlich, den unsere Figur für das Ablegen ihrer alten Kontrolltheorie zahlen muss.
Nach ihrer Entscheidung kämpfen zwei (oder mehr) Versionen ihrer selbst (im Innern der Figur) um die Vorherrschaft. So verzahnen sich äußere Plot-Herausforderungen, Konflikte und Rückschläge und innere Konflikte (zwischen verschiedenen möglichen Versionen der Figur).
Unterhalb der Bewusstseinsebene sind wir eine wilde Demokratie von Mini-Ichs, die, (…) in einem „chronischen Kampf“ um die Vorherrschaft stehen. Unser Verhalten ist „einfach das Endergebnis dieser Kämpfe“.
Will Storr
IV. Akt: »Kann ich den Schmerz der Veränderung ertragen?«
Das zentrale Ereignis des vierten Akts ist die größte Niederlage, der tiefste Tiefpunkt, die dunkelste Stunde unserer Hauptfigur.
Sie zweifelt an ihrem Entschluss zur Veränderung, fragt sich, ob sie ohne den Schutz ihres Glaubenssystem überleben könne, sie bläst zum Rückzug zu ihrer alten Strategie.
Im vierten Akt bietet sich überdies auch an, das Ur-Ereignis, das zur fehlerhaften Kontrolltheorie führte, zu erzählen.
Abermals wird die dramatische Frage »Wer werde ich sein?« gestellt. Es wird deutlich, dass sich die Hauptfigur bald unwiderruflich wird entscheiden müssen.
V. Akt: »Wer werde ich sein?«
Zentrales Ereignis des fünften Akts ist die letzte Prüfung, der finale Kampf, die Konfrontation der Hauptfigur mit ihrer größten Angst. Besteht sie die übermenschliche Herausforderung, gewinnt sie die Schlacht, wird ihr Sieg, so Storr, zum »Gottesmoment« (»God Moment«), in dem sie völlige Kontrolle über ihre innere und damit auch über ihre äußere Welt erlangt.
Im archetypischen Happy End erleben wir, wie die Hauptfigur zu einer neueren, besseren Version ihrer selbst reift.
Endet die Story tragisch, verharrt die Figur bei ihrem fehlerhaften Glaubenssystem, macht sie es schlimmer und schlimmer, wendet sich gar unmoralischem Verhalten zu.
Anstatt den Schaden zu heilen, folgt dann die tribale Strafe auf dem Fuße: Demütigung, Verbannung, Ächtung, Verfemung dessen, was sie (geworden) ist, die Figur muss Gefangenschaft, manches Mal gar den Tod gewärtigen.
Gewährleistet ist aber bei beiden Möglichkeiten des Endes, dass sich Befriedigung einstellt, weil die dramatische Frage, wer die Figur sei, klar beantwortet wurde.

Mein Fazit: Starke Storys dank Wissenschaft?
Für Will Storrs The Science of Storytelling {*} kann ich guten Gewissens eine klare Buchempfehlung aussprechen.
Fraglos lohnt die Lektüre für uns Erzähler:innen. Im Vergleich mit anderen Ratgebern zum Schreiben, zumal Manualen für das Verfertigen von Drehbüchern, sticht angenehm heraus, dass Storr Charakterdesign, Perspektive und Wahrnehmung in den Blick nimmt und sich nicht allein auf die Architektur der »richtigen« Plotstruktur verlegt.
Gleichwohl Storr von der Hauptfigur ausgeht und auch andere Schlüsse als allein das Happy End beschreibt, auch auf andere Arten offener, ambivalenter Geschichten verweist, dominiert bei ihm doch das populäre, »kausale« Erzählen eines zentralen Konflikts sowie des Wandels der Hauptfigur. Insofern ist sein Ansatz vorwiegend »klassisch«, was seine Verwendung der althergebrachten Fünfaktstruktur belegt.
Erfrischend – im Vergleich vor allem zu populären Drehbuchratgebern – ist, dass er ein Verharren der Hauptfigur beim Status Quo respektive Rückkehr zu demselben oder der Wandel hin zu veritablen Antiheld:innen überhaupt als Möglichkeiten erwägt – was zahlreiche Manuale zum Schreiben populärer Film- und Fernsehstoffe oder Romane unterlassen.
Vorzüglich finde ich auch Storrs Rekurs auf Shakespeare, sein Hinweis, dass, zumal beim Charakterdesign, ein Zuviel an erklärender »Kausalität« Schaden anrichtet.
Denn: Es steht faszinierenden Figuren gut zu Gesicht, wenn sie uns immer wieder überraschen und ein gutes Stück weit geheimnisvoll bleiben.
Was Storr vernachlässigt, ist humoristisches Erzählen, das seine Komik oftmals gerade aus der Starrheit der Charaktere bezieht, die ihre »Kontrolltheorien« überraschenderweise und wider jede Vernunft nicht infrage stellen, obzwar sie doch offenkundig fehlerhaft sind.
Ebenso wenig verweist er auf modernistisches Erzählen, bei dem die Erzählstruktur einer akausalen Reihung gleicht, auch das Erzählen über Figurenensembles, Storys, bei denen etwa die Uniformität oder Austauschbarkeit der Hauptfigur(-en) und die Statik der Verhältnisse vermittelt werden sollen.
Storrs Fokus auf Kampf um Dominanz, Überleben und Status, Konflikthaftigkeit mag einigen überdies als Ausdruck einer fragwürdig-maskulinen Erzählweise erscheinen, der Ursula K. Le Guin bereits 1986 ihre »Tragetaschentheorie des Erzählens« (engl. »Carrier Bag Theory of Fiction«) {*} als Alternative entgegensetzte.
Indem Storrs Ansatz Erkenntnisse aus Neurowissenschaft, Hirnforschung und Psychologie nutzt, stellt er das Erzählen auf eine solide, allgemeinmenschliche Grundlage und garantiert so, dass es jeden erreicht. Dies ist einerseits ein klarer Vorzug.
Andererseits birgt dieser Ansatz die Gefahr, beim Fokus auf unser gemeinsames Erbe zu übersehen, dass wir auf eine Jahrtausende alte Tradition des Erzählens zurückblicken, die ihrerseits etliche Wandlungen durchlief.
Wer sich auf das kapriziert, was allgemeinmenschliche Grundlage ist, dem entgehen womöglich Innovationen des Erzählens, die sich mitunter gerade von dem uns »natürlichen« Konzept von Erzählen abgrenzen.
Wer die kontinuierliche Weiterentwicklung des Erzählens, den Wandel im Welt- und Menschenbild und des Zeitgeists ignoriert, der gerät womöglich in Gefahr, lediglich Althergebrachtes zu reproduzieren.
Dies ist aber Kritik auf einem Niveau, das einen wohl allzu hohen Anspruch an einen populären Erzählratgeber stellt.
Fest steht: Storrs Buch hält praktikable Unterweisungen für all jene bereit, die selbst populär und spannend zu erzählen wünschen.
Überdies überrascht es immer wieder mit erhellenden Einsichten darüber, wie unser Gehirn Geschichten verarbeitet und aus unserem eigenen Leben eine spannende »Story« verfertigt.
Mit herzlichem Gruße
Euer

Postskriptum: Wenn mein Artikel erbaulich, erhellend oder nützlich für Dich war, teile ihn doch gerne mit anderen Storytelling-Enthusiasten. Herzlichen Dank im Voraus!

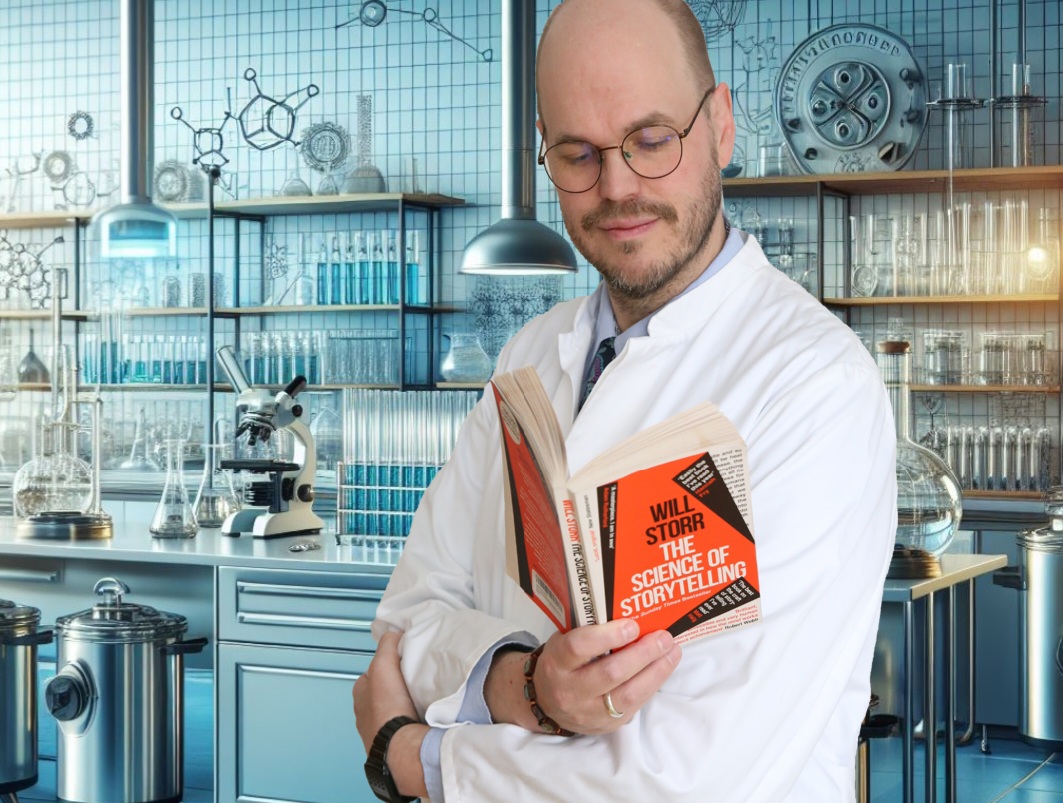
Schreibe einen Kommentar